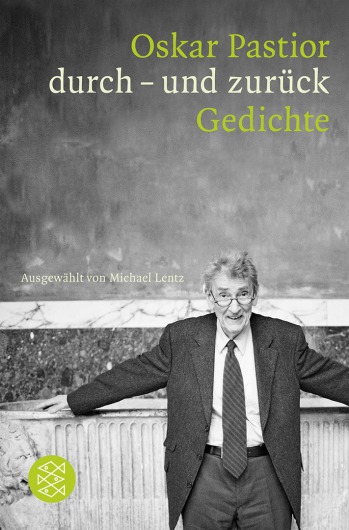34-2 ist reserviert
Mit dem Senatsbeschluss vom 12. Juli 2016 wurde das Grab des Schriftstellers Oskar Pastior auf dem Friedhof Stubenrauchstraße zur „Ehrengrabstätte“ des Landes Berlin erklärt. Pastior aber war nicht nur Lyriker und Übersetzer, sondern unter dem Decknamen „Otto Stein“ auch inoffizieller Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes „Securitate“ von Diktator Ceaușescu. Das ist an sich schon moralisch verwerflich. Schlimm ist aber, dass er darüber zeitlebens geschwiegen hatte, selbst seiner „guten Freundin“ Herta Müller gegenüber, mit der er doch einige Zeit an einem gemeinsamen Roman über die Figur des Leopold Auberg arbeitete – der Lebensgeschichte von Oskar Pastior.
Oskar Pastior starb am 4. Oktober 2006. Seine sterblichen Überreste wurden auf dem Friedhof Stubenrauchstraße in der 1x1 Meter großen Urnen-Wahl-Grabstätte 34-1 beigesetzt. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft hatten zuvor auf 34-2 die Schwartzkopffs und auf 34-3 die Gehlhaars ihre letzte Ruhe gefunden. Nach dem Jahr 2010 müssen die Nutzungsrechte für das Schwartzkopff-Grab ausgelaufen sein.
Inzwischen war einiges geschehen. Testamentarisch hatte Pastior die Gründung einer Oskar-Pastior-Stiftung und alle zwei Jahre die Verleihung eines Oskar-Pastior-Preises mit einem Preisgeld von 40.000 Euro verfügt. Herta Müller schrieb den mit Oskar Pastior geplanten Roman nach einer pietätvollen Wartezeit alleine weiter. „Atemschaukel“ wurde am 17. August 2009 vom Carl Hanser Verlag München ausgeliefert. Bis zur Verkündung des Literaturnobelpreises am 8. Oktober 2009 blieben dem Nobelkomitee 50 Tage, um sich mit den Werken der fünf verbliebenen Kandidaten vertraut zu machen. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki hat jeden Kommentar zum Literaturnobelpreis für Herta Müller abgelehnt: „Ich will nicht über sie reden." Da sei viel Politik im Spiel.
Kaum war die „Ehrengrabstätte“ beschlossene Sache, ging es auf dem Friedhof Stubenrauchstraße ratzfatz weiter. Am 25. Juli 2016 war der Schwartzkopffsche Grabstein verschwunden und Pastiors Grabstätte mit Pflanzungen auf 34-1-2 erweitert. Am 19. August 2016 lag auch schon der bekannte rötliche Backstein mit der Aufschrift „Ehrengrab Land Berlin“.
Seit dem 2. September 2016 wissen wir es genau. Da teilte uns Pastiors Freund Ernest Wichner mit, dass für das erweiterte Grab „in Teilen die Stiftung und ansonsten Herta Müller und ich für alle Kosten aufkommen, die mit Oskar Pastiors Grab zu tun haben“. Für wen ist nun 34-2 „reserviert“? Irgendwann muss der Gräberplan für den Friedhof Stubenrauchstraße ergänzt werden.
Der Fall Oskar Pastior
Am 7. Juni 2016 wurde die Grabstätte 34-1 von Oskar Pastior auf dem Friedhof Stubenrauchstraße zur „Ehrengrabstätte des Landes Berlin“ erhoben. Pastior war Schriftsteller, aber unter dem Decknamen „Otto Stein“ auch Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate.
Für mich, der im Juli 1973 im Kofferraum eines PKW von Ost- nach West-Berlin geflohen ist, dem bis zum Fall der Mauer der östliche Teil Deutschlands und Familientreffen 16 Jahre versagt waren, und der später in seiner Gauck-Akte über sich die IM-Berichte seiner „angeblichen“ Freunde lesen konnte, ist diese „Ehrung“ fragwürdig. Nach 1990 hat sich keiner der mich bespitzelnden Informanten dazu geäußert.
Ich kannte das System, ich erfuhr, dass Karriere ohne SED und Stasi schwierig war. Dreimal wurde, auch das ist in der Akte dokumentiert, der Versuch gestartet, mich als IM anzuwerben. Ich habe mich dem entzogen. Das war nicht einfach. Deshalb hätte ich für manchen Spitzelfreund und für manchen Bericht (vielleicht) Verständnis aufgebracht. Aber sie schwiegen.
Auch Oskar Pastior schwieg, selbst gegenüber seiner Vertrauten Herta Müller verbarg er seine Spitzeltätigkeit. Im Nachwort des 2009 mit dem Literaturnobelpreis dekorierten Roman „Atemschaukel“ berichtet Müller vom Entstehen des Buches: Sie tat sich mit Pastior zusammen, der als 18-jähriger rumäniendeutscher Homosexueller deportiert worden war und von seinen Erlebnissen aus der sowjetischen Lagerzeit erzählte. Aus diesen Gesprächen erwuchs die Idee, ein Buch gemeinsam zu schreiben. Am 4. Oktober 2006 starb Oskar Pastior.
Im April 2008 haben Herta Müller und Ernest Wichner den testamentarischen Willen von Pastior erfüllt: Die Gründung der „Oskar-Pastior-Stiftung“, die von ihm namentlich festgelegte Benennung des Stiftungsrats, die Vergabe eines Oskar-Pastior-Preises und die Übergabe seines Nachlasses an das Deutsche Literaturarchiv in Marburg.
Irgendwann dazwischen hat sich Herta Müller entschlossen, den einst gemeinsam geplanten Roman allein weiter zu schreiben – die Geschichte von Oskar Pastior aus Hermannstadt in Siebenbürgen, der nun als Romanfigur Leopold Auberg „von der Nacht zum 15. Januar 1945 erzählte“, als ihn die Patrouille abholte und in ein sowjetisches Arbeitslager brachte. Pastior als Ich-Erzähler. Freimütig gesteht Herta Müller: „Ohne Oskar Pastiors Details aus seinem Lageralltag hätte ich es nicht gekonnt.“
Am 17. August 2009 lieferte der Carl Hanser Verlag „ihren“ Roman „Atemschaukel“ aus. Bis zur Verkündung des Literaturnobelpreises am 8. Oktober 2009 blieben dem Nobelkomitee 50 Tage, um dieses Buch zu lesen und sich dann zwischen den fünf verbliebenen Kandidaten zu entscheiden. Nach dem nun bekannt gewordenen und noch nicht aufgeklärten Missbrauchsskandal um die Jury des Literaturnobelpreises wundert man sich über gar nichts mehr. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki hielt schon damals die deutsche Gegenwartsliteratur für „uninteressant“. Es gebe „nicht einen einzigen“ deutschen Roman der vergangenen Jahre, der ihn begeistert habe. „Geradezu lächerlich“ nannte er es, dass „John Updike und Philip Roth bis heute keinen Literaturnobelpreis bekommen haben". Hier sei viel Politik im Spiel. Wollte er im Herbst 2009 deshalb „nicht über Herta Müller reden“?
Plötzlich war Herta Müller ein Name. Endlich war sie raus aus der literarischen Nische und den geringen Auflagen. Im September 2010 wurde bekannt, dass Oskar Pastior von 1961 bis zu seiner Flucht in den Westen 1968 dem rumänischen Geheimdienst „gedient“ hatte. Die Meldung kam zur Unzeit.
Herta Müller ist bei jedem Anlass zu einem Statement bereit. In Erinnerung ist noch ihre geschmacklose Bemerkung zu dem abstrusen Gedicht von Günter Grass, den sie an den Pranger stellte, weil „er ja nicht ganz neutral ist. Wenn man mal (als 17-Jähriger) in der SS-Uniform gekämpft hat, ist man nicht mehr in der Lage, neutral zu urteilen“. Kein Wort davon, dass ihr Vater (als Erwachsener) bei der SS war, und sie in ihren Roman „Herztier“ versuchte, sein Wirken zu verharmlosen, da der rumänische Geheimdienst Securitate zwischen 1948 und 1990 „viel schlimmer als die SS gewütet habe“. Nach der Enthüllung zu Pastior zeigte sich Herta Müller „enttäuscht“, „bestürzt“, „entsetzt“, „verbittert“. „Es sei natürlich schrecklich, wenn man von jemandem, den man zu kennen glaubte, etwas Dunkles, kaum Fassbares erfahre, etwas, was einem nie anvertraut wurde. Dann aber habe sie sich darauf besonnen, wie verletzbar, erpressbar Pastior gewesen sei: ein Homosexueller in einem Staat, der Homosexualität mit mehreren Jahren Haft ahndete“.
Jetzt ging es um Schadensbegrenzung – moralische Aspekte blieben außen vor. Ernest Wichner, Vertrauter Müllers und Freund Pastiors, keinesfalls also ein unabhängiger Forscher, wurde Anfang Januar 2011 nach Bukarest geschickt. Dort sollte er offenbar herausfinden, wem Oskar Pastior als IM „Stein Otto“ wirklich geschadet hat und ob es noch weitere Opfer Pastiors geben könnte. Erleichtert kam er zurück. In den ihm zugänglich gemachten Akten, viele davon sind in Rumänien noch immer unter Verschluss, hatte er „nichts wirklich Neues“ entdeckt. Laut „Spiegel“ vom 17. Januar 2011 „klingt Wichner, als wolle er sich gegen Vorwürfe verwahren, noch ehe sie ausgesprochen sind. Nicht wenige, darunter alte Freunde, sehen ihn inzwischen zu emsig das Rampenlicht mit der Nobelpreisträgerin teilen“. Für ihn „war Oskar wie ein Vater oder Bruder, noch als Toter ist er mir nah. Aber deshalb arbeite ich nicht darauf hin, dass jenes Ergebnis herauskommt, das ich mir wünsche. Darin bin ich mir mit Herta Müller einig“.
Es wunderte nicht, dass Ernest Wichner als einziger der alten rumänischen Weggefährten, ob „Aktionsgruppe Banat“ oder „Temeswarer Literaturkreis“, dem Herta Müller angehörte, dabei war, als ihr am 10. Dezember 2009 der schwedische König den Nobelpreis überreichte. „Von Hertas Licht“, sagte der einstige Mitstreiter Richard Wagner, „wollen jetzt viele etwas abhaben, das ist menschlich verständlich. Und ein Nobelpreis gibt ja auch Legitimation. Aber Herta Müller und Ernest Wichner „sind auf einem Auge blind. Für die beiden ist Oskar Pastior eine Art Heiliger“. Nun, nach der Enttarnung von Pastior als Spitzel „hätten sie die Sache gern kleiner, harmloser, und sie glauben daran, dass es so war. Aber da werden noch einige neue Sachen ans Licht kommen. Die Stiftung und der Preis mit seinem Namen sind nicht zu halten.“
Herta Müller wollte retten was zu retten ist: „Wir von der Pastior-Stiftung werden eine Forschergruppe beauftragen, das ganze Umfeld Pastiors zu untersuchen. Wir müssen es uns jetzt zur Aufgabe machen, die Verstrickung von Schriftstellern und Geheimdienst in der Diktatur – auch an Pastiors Beispiel – zu untersuchen. Aber das geht nicht von heute auf morgen.“ Es ging von heute auf morgen. Schon 2012 erschien in der Reihe „text+kritik“ ein Sonderband mit 140 Seiten unter dem Titel „Versuchte Rekonstruktion - Die Securitate und Oskar Pastior“ – Herausgeber Ernest Wichner. Die offizielle Verlagsankündigung lautet: „Versuchte Rekonstruktion – unter diesem Titel fand sich im Nachlass von Oskar Pastior eine Notiz zu seinen Erinnerungen an den „Ekelkomplex“ Securitate. War Pastior ein wertvoller Informant? Auf welche Weise lässt sich die Securitate-Erfahrung in seinem Werk auffinden? Der Sonderband analysiert alle bislang zugänglichen Materialien und bewertet diese im politischen und kulturellen Kontext der Zeit.“
In den umgehend erschienenen Rezensionen heißt es: „Die Autoren des Bandes – vor allem Ernest Wichner – betonen allerdings, dass die Informationen, die Pastior der Securitate mitgeteilt hat, für diese völlig nutzlos gewesen sein müssen. So nutzlos, dass aus ihnen keinerlei Nachteil für die Bespitzelten entstanden sein kann, Pastior aber trotzdem durch seine Arbeit geschützt war. Die wenigen von Pastior geschriebenen Berichte lesen sich auch eher harmlos.“
Eine gewagte Äußerung. Bekannt ist doch, dass der „Rumänische Nachrichtendienst SRI“ als Nachfolger von „Securitate“ die Aufklärung nach 1990 nur „sehr schleppend“ betrieb und viele Akten noch nicht zugänglich sind. In der Dokumentation wird ausdrücklich betont, dass sich Pastior nach seiner Flucht „dem westdeutschen Geheimdienst und der CIA anvertraute, um ‚reinen Tisch‘ zu machen“. Was hat er denn ausgeplaudert und was nicht? Gegenüber Herta Müller, Ernest Wichner, Richard Wagner und anderen hat er seine geheimdienstliche Tätigkeit verschwiegen. Das ist moralisch verwerflich.
Mit Blick auf den hiesigen Umgang mit den Stasiakten ist die Ehrung für einen sich zeitlebens nicht offenbarenden rumänischen Spitzel ein Fehler. Die Preisträger des mit einer Dotation von 40.000 Euro versehenen Oskar-Pastior-Preises sollten bedenken, dass dieses Geld vom Konto eines Spitzels stammt.
Peter Hahn, 26. April 2018
Oskar-Pastior-Stiftung und Oskar-Pastior-Preis
Pastiors „Sparsamkeit war gefürchtet. Er hat beinahe alles an Geld, was in seine Hände kam, auf die hohe Kante gelegt. So ist nach seinem Tod, testamentarisch von ihm verfügt, eine Stiftung mit seinem Namen eingerichtet worden, und auch ein Oskar-Pastior-Preis wurde ins Leben gerufen“. (Richard Wagner, rumänisch-deutscher Schriftsteller und neben Ernest Wichner 1972 Mitbegründer der „Aktionsgruppe Banat“)
Die „Oskar Pastior Stiftung“ wurde im April 2008 im Literaturhaus Berlin gegründet. Benannt hatte Pastior in seinem Testament auch „die Mitglieder des Stiftungsrates“: Marianne Frisch, Herta Müller, Klaus Ramm, Dierk Rodewald, Ulf Stolterfoht, Christina Weiss und Ernest Wichner. Die Stiftung vergibt alle zwei Jahre den Oskar Pastior-Preis, dotiert mit 40.000 Euro. Ausgezeichnet werden Autoren, deren Werke in der Tradition der Wiener Gruppe (um H. C. Artmann) stehen. Die Stiftung kann auch die literarische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Literatur sowie dem Werk von Oskar Pastior fördern. Seinen Nachlass hat das Deutsche Literaturarchiv in Marburg erworben – oder erhalten?
Die bisherigen Preisträger:
2010 Oswald Egger (geb. 1963 in Südtirol) Begründung: „Oswald Egger erkundet in seinem Werk die vielstimmigen Erscheinungs- und Wahrnehmungsformen von Welt in Sprache. Mit Spielwitz und Risikofreude macht er noch die entlegensten Vokabularien und Wortschätze zum Material seiner mathematisch-poetischen Versuchsanordnungen und treibt so die Traditionen experimentellen Schreibens voran.“
2012 Wegen der bekannt gewordenen Verstrickungen von Oskar Pastior als Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienst Securitate verzichtete die Stiftung 2012 auf eine Preisverleihung.
2014 Marcel Beyer (geb. 1965 in Baden-Württemberg) Laudatio von Christina Weiss: Das Werk von Marcel Beyer „zeichnet sich durch eine intensive Beobachtung des sprachlichen Materials aus, die durch die harten Themen hindurch in offenes poetisches Gelände führt. Er bewegt sich im Energiefeld der Sprache, ein Besessener der Geheimnisse der Wörter, die er aus scharfer Beobachtung den Dingen ablauscht." Juroren waren die Mitglieder des Stiftungsrats: Klaus Ramm, Marianne Frisch, Christina Weiss, Ulf Stolterfoht, Dierk Rodewald, Herta Müller und Ernest Wichner.
2016 Anselm Glück (geb. 1950 in Oberösterreich) Begründung: Anselm Glück hat Werke geschaffen, „die der experimentellen und konkreten Kunst verpflichtet, eine sehr eigene, unverwechselbare Diktion aufweisen“.
2018 Ein Preisträger ist bisher nicht bekannt.
Links
Stimmen zum Fall Oskar Pastior
Der verstrickte Gefährte
Herta Müller und Oskar Pastior
Süddeutsche Zeitung, 17.09.2010
Lyriker als IM
Herta Müller erschrocken über Pastiors Securitate-Tätigkeit
DER SPIEGEL, 17.09.2010
Oskar Pastior: Der Dichter als Informant
18.09.2010
Von Richard Wagner
http://www.achgut.com/artikel/oskar_pastior_der_dichter_als_informant/
Auch du, mein Freund
DER SPIEGEL
20.09.2010
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-73892439.html
Oskar Pastior. mein Freund, der Securitatespitzel
Von Dieter Schlesak
20.09.2010
Securitate-IM Pastior wird wie ein Opfer behandelt
WELT, 17.10.2010
Von Richard Wagner
https://www.welt.de/kultur/article10319311/Securitate-IM-Pastior-wird-wie-ein-Opfer-behandelt.html
Wir wurden erpresst
Ich verstehe meinen Freund, den Dichter und Securitate-Spitzel Oskar Pastior.
Von Dieter Schlesak
23. September 2010
https://www.zeit.de/2010/39/Oskar-Pastior
Herta Müller bestürzt über Spitzelei Pastiors
DIE ZEIT, 17.11.2010
http://www.zeit.de/kultur/literatur/2010-11/pastior-mueller-securitate
Vom Nachlass zur Hinterlassenschaft
Das Doppelleben Oskar Pastiors als Dichter und Informant der Securitate.
Von Richard Wagner
Neue Züricher Zeitung, 18.11.2010
http://www.nzz.ch/vom-nachlass-zur-hinterlassenschaft-1.8414825
Gift im Gepäck
DER SPIEGEL, 17.01.2011
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-76397429.html
Oskar Pastior und die Securitate
Schluchten des Argwohns
Die Wogen schlugen hoch, als herauskam, dass Oskar Pastior einst Zuträger der Securitate war. Ein Forschungsvorhaben soll nun aufklären, was der verstorbene Büchner-Preisträger getan hat - und was nicht.
FAZ, Regina Mönch, 25.06.2012
Weiteres in Vorbereitung